Nachhaltige Beschaffung
Vom Preis- zum Qualitätswettbewerb
Die öffentliche Hand, seien es Gemeinden, der Kanton, der Bund oder deren Betriebe, sind für KMU und Gewerbe wichtige und grosse Kunden.
Wenn sie Aufträge ausschreiben, können sie dank dem kürzlich revidierten Beschaffungsrecht nun mehr Gewicht auf Qualität und Nachhaltigkeit legen.
Vortrag vom 19. Juni 2025 von Bundesverwaltungsrichter Marc Steiner
Bericht der Veranstaltung

Bundesverwaltungsrichter Marc Steiner begeisterte für das neue Beschaffungsrecht.
Wer der Einladung des Gewerbevereins Affoltern und der Standortförderung Knonauer Amt folgte, erlebte einen Bundesverwaltungsrichter, der mit Verve für eine mutige Umsetzung des revidierten Vergaberechts warb.
Rund fünfzig Verantwortliche waren gekommen, sowohl vom Gewerbe, der Anbieterseite, als auch vonseiten Stadt und Gemeinden, der Vergabeseite öffentlicher Beschaffungen. Es geht um viel: Bund, Kantone, Städte und Gemeinden beschaffen jährlich Güter und Dienstleistungen in der Höhe von über 40 Milliarden Franken. Davon entfallen 40 Prozent auf Städte und Gemeinden. «Mit einem so wuchtigen Hebel lässt sich somit ein beachtliches Drehmoment erzielen, um die Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit zu lenken», lässt sich dazu der Züricher Baudirektor Marin Neukom zitieren.
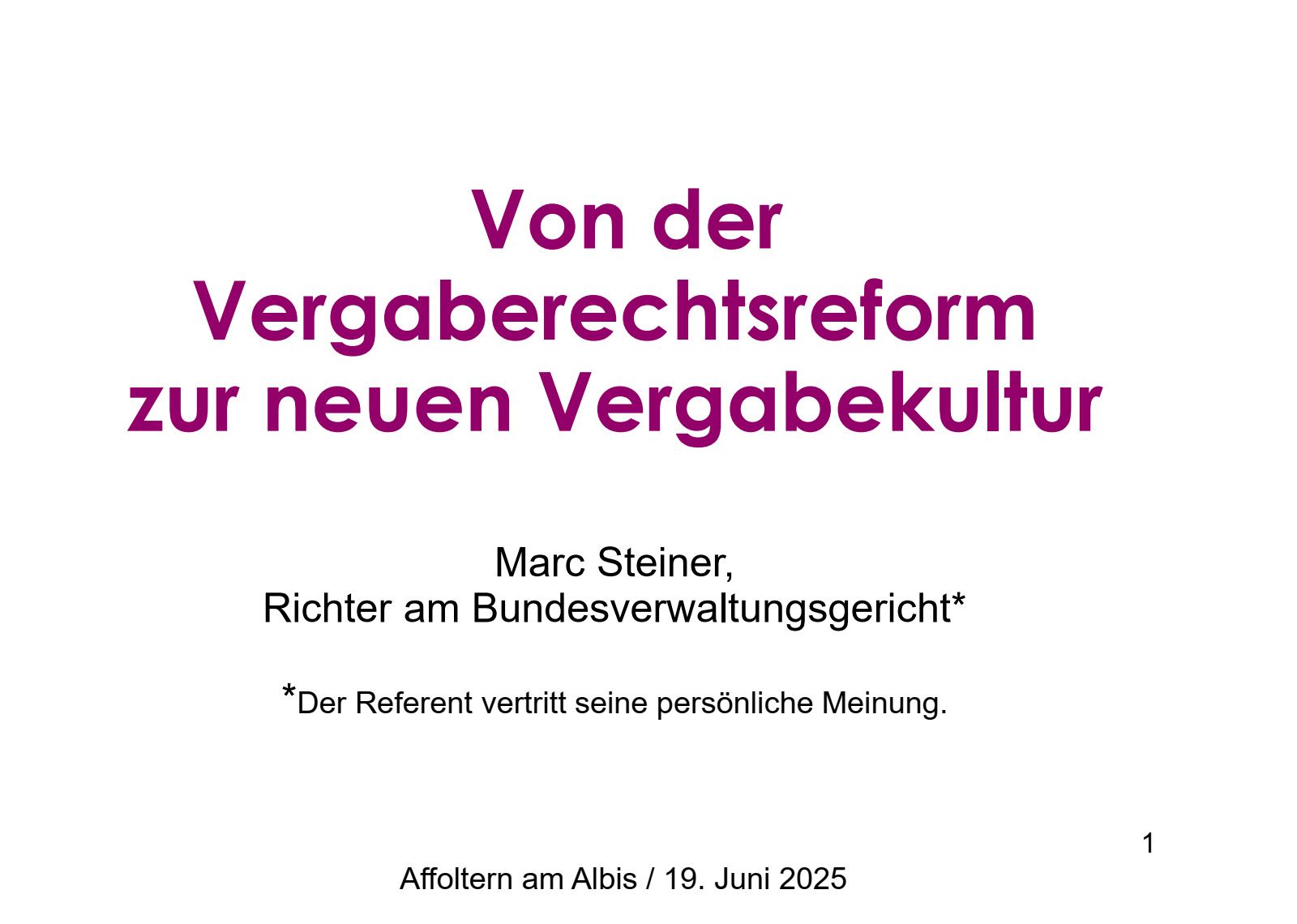
Download Folien des Vortrags von Marc Steiner vom 19.6.2025.
Qualität ist, was gut ist, und das ist komplex
Hier kommt das revidierte Beschaffungsrecht zum Zug, das den Behörden wesentlich mehr Spielraum gibt, ihre Vergabeentscheide aufgrund von Qualitätskriterien zu fällen. Bei komplexen Beschaffungen dürfen Vergabebehörden die Qualität höher als den Preis gewichten und bei besonders komplexen Projekten das Preiskriterium bis zu einer Mindestgewichtung von 20 Prozent drücken. Damit wird die Qualität zum entscheidenden Kriterium. Darum lautet die neue Formel auch: Das vorteilhafteste Angebot erhält den Zuschlag.
Es gehe dabei nicht um die Frage, ob verbaute Bleche zwei oder zweieinhalb Millimeter stark seien, sondern: «Die Qualität einer Beschaffung ist die Summe der Folgen meines Konsumverhaltens, dazu gehören auch Abhängigkeiten, in die ich mich hineinbegebe, aber auch alle ökologischen und sozialen Auswirkungen», so Marc Steiner. Er ist Richter am Bundesverwaltungsgericht und befasst sich dort besonders mit der Umsetzung des öffentlichen Beschaffungsrechts. Er war aber nicht als Richter nach Affoltern gekommen, sondern als Referent, der seine persönliche Meinung äusserte.
Den Aspekt der Abhängigkeiten zeigte er am Beispiel der Energielieferungen aus Russland auf. Nämlich, dass sich Litauen, im Gegensatz zu Deutschland, schon vor Jahren aus dieser Abhängigkeit gelöst habe. Wer sich an dieser Stelle als Schweizer entspannt zurücklehnte, horchte aber gleich wieder auf. Steiner schob nach, dass er gespannt sei, wie wir unsere Abhängigkeiten in Informationstechnologien von US-Firmen — man denke an Software, Cloudspeicher und dergleichen — in den nächsten Jahren bewerten würden.
Einkaufen mit Verantwortung
Zur Sache ging es dann beim Thema ökologischer und sozialer Auswirkungen. Qualität und Verantwortung hat auch hier seinen Preis. Voten von Behördenvertretern gaben zu bedenken, dass Steuerzahler und Stimmbürger auch überzeugt werden müssten, wenn Aufträge an die teureren Anbieter vergeben würden.
Dem rein geldorientierten Mindset von Milton Friedmann «The business of business is business.», setzte Steiner für den öffentlichen Sektor im modernen Verfassungsstaat die Maxime «The purpose of purpose is purpose» entgegen, frei übersetzt in etwa: Der Sinn unserer Verantwortung und Versprechen ist, dass wir uns daran halten — auch wenn es mehr kostet. Und es gehe nun darum, von einer bisher in der Tendenz zu simplen Art, Einkauf zu machen, auf eine ganzheitliche, nachhaltige Sichtweise zu kommen. Die schweizerische Bauwirtschaft, die wesentlich zum Erfolg der Vergaberechtsreform beigetragen habe, differenziere sich ja auch lieber durch die Qualität als durch den Preis.
Soweit ganz im Sinne aller Anwesenden. Von Anbieterseite sagte etwa Andrin Schnider von der gleichnamigen Zimmerei: «Ich verkaufe lieber nachhaltig gute Qualität, als dass ich mich mit einem Preiskampf herumschlage».
Wer soll vorangehen, Gemeinden oder Gewerbe?
Aber es stellte sich sogleich die Huhn-oder-Ei-Frage: Wer setzt die neuen Standards? Ist es Vergabeseite, indem sie in der Ausschreibung höchste Qualität und Nachhaltigkeit fordert, oder die Anbieterseite, indem sie proaktiv höhere Qualität und Nachhaltigkeit offeriert?
Daran schloss sich gleich die nächste bange Frage von beiden Seiten an: Wieweit kann die öffentliche Hand mit Nachhaltigkeitsanforderungen gehen, ohne die Anbieterseite zu überfordern? Kann etwa von jedem KMU realistischerweise verlangt werden, seine gesamte Lieferketten bis ins letzte Glied im Detail zu kennen?
Und von der anderen Seite: wieviel Qualität und Nachhaltigkeit kann ich als Anbieter offerieren, ohne zu riskieren wegen des Preises dann doch den Wettbewerb zu verlieren?
Unter anderem empfahl Steiner, Branchendialoge zu führen: Dass also die Vergabeseite gemeinsam mit den Branchen auslote, wie weit man mit Qualitätsanforderungen gehen könne, so dass immer noch eine vernünftige Anzahl Anbieter im Markt mithalten könnte. Das sei auch eine positive Wirtschaftspolitik. Er warb auch für Pragmatismus: «Wenn sie mit Radikalforderungen kommen, und dann keine Anbieter finden, ist das ja auch nicht mehr sinnvoll.»
Ermessenspielräume nutzen heisst Risiken eingehen
Im interaktiven Vortrag wurde deutlich, dass Ausschreibungen und Zuschläge künftig nicht nur komplexer, sondern noch mehr als bisher auch auf Ermessensentscheidungen fussen werden. Dies, weil Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien schwer bewertbar seien. Preisvergleiche sind dagegen einfach – und kaum anfechtbar. «Ich teile die Begeisterung für Nachhaltigkeit, aber andererseits würde ich auch gerne ohne Gerichtsprozesse bauen», sagte dazu ein Behördenmitglied.
Der Bundesverwaltungsrichter zeigte zwar volles Verständnis, aber Risikoaversion sei trotzdem der falsche Ratgeber: Wer nach der Maxime handle, sich bloss nicht angreifbar zu machen, stehe einer neuen Vergabekultur im Wege, die eigentlich alle wollten. «Wir müssen eine Art finden, wie wir die Spielräume gut nutzen, die Vergabeprozesse so brauchen, dass sie Innovation und Nachhaltigkeit fördern». Ja, das bedeute mehr Aufwand auf beiden Seiten, aber der lohne sich. Und er wies darauf hin, dass hier alle Parteien, einschliesslich Gerichte, noch am Lernen seien.
Und schliesslich gab er insbesondere für kleine Gemeinden – also auch Teile des Säuliamts – zu verstehen, es gebe eigentlich nur einen Weg, sich nicht zu überfordern, nämlich sich helfen zu lassen, «lassen Sie sich vom Kanton unterstützen!», und in Kooperation zu gehen: «Warum nicht einen gemeinsamen Beschaffungs-Zweckverband für mehrere Gemeinden bilden?»
Beim anschliessenden Apero wurde rege weiterdiskutiert. Dominique Lipp, Vorstandsmitglied des Gewerbevereins Affoltern und Standortförderer Johannes Bartels waren sich einig: «Das Thema ist wichtig und es gibt noch viel zu tun».
